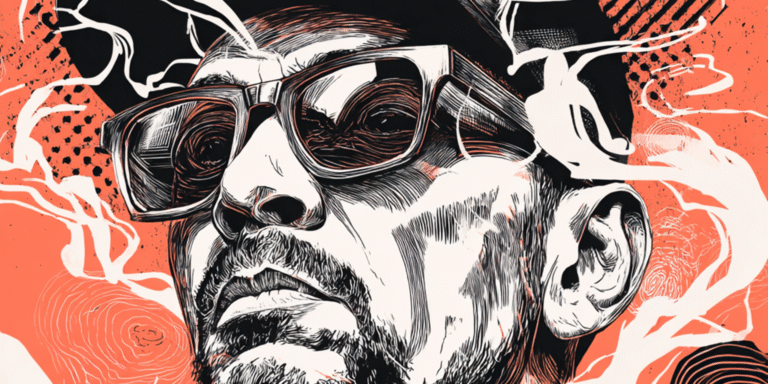Wie kann Schule Räume schaffen, in denen Vielfalt nicht nur toleriert, sondern anerkannt und geschützt wird? Und was braucht es, um mit Schüler*innen über Queerfeindlichkeit, aber auch über Sexismus, Rassismus oder Männlichkeitsbilder ins Gespräch zu kommen – ohne zu stigmatisieren und ohne einfache Antworten? Ein Kommentar von Jochen Müller, Co-Geschäftsführer von ufuq.de.
In der vergangenen Woche ging eine Berliner Grundschule durch die Medien, an der ein schwuler Lehrer von – so wurde berichtet – mehrheitlich muslimisch-migrantischen Kindern massiv beleidigt und bedroht wurde. Offenbar erhielt er daraufhin von Schulleitung und Kollegium wenig Rückendeckung. Viel mehr und viel Genaueres wissen wir im Grunde nicht und wie meistens, dürften sich auch hier die Erzählungen und Perspektiven der Beteiligten auf die Ereignisse und deren Geschichte unterscheiden.
Im Folgenden sollen daher nicht die Schule und der „Fall“ im Vordergrund stehen, sondern das Konfliktfeld: Homo-, Trans- und Queerfeindlichkeit. In den vergangenen Monaten hat sich hier das gesamtgesellschaftliche Klima spürbar verändert. Es kann mittlerweile wieder zum „guten Ton“ gehören, sich abwertend und aggressiv gegenüber Frauen und gegenüber Menschen zu verhalten, die nicht heteronormativ sind und/oder leben. Die Sozialen Medien sind voll mit entsprechenden Angeboten, die sich vor allem an junge Menschen aller Herkünfte, Religionen, Milieus und Klassen richten und ihnen zeigen, was ein richtiger Mann und was eine richtige Frau ist. Die Nachfrage ist groß. Klar, dass sich das auch im Sozialraum Schule abspielt und dort eigene Dynamiken entfalten kann.
Vor diesem Hintergrund ist es vielleicht angemessen, entgegen all der Aufregung, die so ein „Fall“ erzeugt, lieber einen Schritt zurückzutreten, innezuhalten und sich bewusst zu machen, dass es in solchen Dynamiken zunächst nur Verlierer*innen gibt: der betroffene Lehrer, die Schule mit Leitung und Kollegium und auch die Kinder, die zu „Täter*innen“ geworden und gleichzeitig Opfer der sie prägenden Diskurse, Lebenswelten und Verhältnisse sind. Denn in die Verstrickungen vor Ort wirken eine Vielzahl auch gesamtgesellschaftlicher, ja globaler Faktoren, denen alle Beteiligten und Betroffenen zunächst ohnmächtig gegenüberstehen, weil sie diese nicht oder kaum beeinflussen können. Trotzdem kann und muss gehandelt werden – gerade im pädagogischen Raum.
Wenden wir uns also noch einmal den Schulen zu. Im gegebenen Fall erscheinen Interventionen seitens der Schule gegenüber einzelnen Schüler*innen unumgänglich, denn offenbar sind hier rote Linien überschritten worden. Aber: Selbst wenn im Einzelfall Repressionen und Sanktionen bis hin zu Schulverweisen erforderlich erscheinen, sollen diese aus pädagogischer Perspektive ja gelingen – das heißt, alle Interventionen sollten das Ziel verfolgen, nicht nur die betreffende Person, sondern so viele Kinder und Jugendliche wie irgend möglich zu erreichen und mitzunehmen. Tatsächlich wissen wir aus unserer Arbeit in Schulen, dass wir in einem geeigneten Setting sehr gut mit Jugendlichen über verschiedene Formen von Diskriminierung, wie hier der Homofeindlichkeit aber auch über Rassismus, Sexismus, Klassismus oder Antisemitismus, reden und ihre Sensibilität fördern können – nicht zuletzt, weil viele von ihnen eigene Erfahrungen mit Diskriminierung mitbringen. Schließlich sind Abwertung und Mobbing unter Jugendlichen in Suchprozessen und insbesondere bei solchen, die selbst verschiedene Formen von Ausgrenzung erleben, sehr oft Ausdruck von mangelndem Selbstwertgefühl und ein Versuch, daraus eigene Stärke und Macht zu begründen und zu demonstrieren.
Gleichwohl gilt es in der pädagogischen Arbeit ja nicht nur, Diskriminierungssensibilität zu stärken, sondern auch die grundlegende Akzeptanz vielfältiger Lebensformen, Geschlechterbilder und Sexualitäten zu fördern und auch einzufordern. Dabei ist zu bedenken: Sexismus, Homo-, Trans- und Queerfeindlichkeit gibt’s immer und überall. Binäre und heteronormative Geschlechter- und Rollenbilder, Denk- und Verhaltensmuster sowie gewaltlegitimierende Normen von Männlichkeit und Weiblichkeit sind unseren individuellen Mindsets und unseren Gesellschaften eingeschrieben. Zwar mögen sie in manchen Milieus stärker verbreitet sein als in anderen. Als universelle Strukturelemente patriarchaler Kulturen kommen sie aber in den besten Familien vor. So hätte es noch in den 60ern und bis in die 70er Jahre in den Schulen, die der Autor dieser Zeilen besucht hat, niemand jemals gewagt, seine oder ihre Homosexualität zu erkennen zu geben. Es blieb bei fiesen Sprüchen und Gerüchten, die unter den Schüler*innen und ihren Eltern umgingen.
Veränderung dauert also, ist aber möglich. Auch das Gespräch vor Ort in der Schulklasse oder der Jugendgruppe kann gelingen – wenn es kontinuierlich gesucht wird und wenn keine spezifischen „Problemgruppen“ wie etwa „Rechte“, „Populisten“ oder „Muslime“ adressiert werden. Pädagogisches Ziel ist dabei nicht etwa die Veränderung (Wer will sich schon verändern lassen?), sondern es geht zunächst darum, unterschiedlichen Vorstellungen, Traditionen und Perspektiven Raum zu geben und sie in den Austausch miteinander zu bringen. Das ist immer eine Gratwanderung und wird wie gesehen nicht immer „funktionieren“ – zumal alle Schulen und Pädagog*innen hier vor der schweren Aufgabe stehen, gerade „schwierigen“ Kindern und Jugendlichen zuzuhören und ihre Erfahrungen und Lebenswelten mitzudenken, um sie erreichen, ihre Überzeugungen irritieren und Veränderungsprozesse anzustoßen zu können, gleichzeitig aber andere Jugendliche im Klassenraum vor Abwertungen, Beleidigungen und Gewalt schützen zu müssen.
Hierzu braucht es Regeln, Routinen und Verweisstrukturen. Die gibt es in vielen Schulen, Kommunen und Bundesländern bereits. Außerdem braucht es Zuversicht: Vertrauen in den Prozess und in die Jugendlichen. Vor allem aber braucht es – und auch die gibt es bereits an jeder Schule – selbstreflektierte, diskriminierungssensible, ambiguitätskompetente und empathische Fachkräfte. Am Ende ist es nämlich immer auch eine Frage der Ressourcen, der Angebote und des Klimas in Klasse und Schule (und Gesellschaft), ob und in welcher Form schwierige, sensible und kontroverse „Fälle“ und Themen besprechbar sind oder ob es zu schmerzhaften Kulturkämpfen kommt. Daran kann und sollte jede Schule (und jede Bildungsverwaltung) arbeiten. Das ist ein langer, schwieriger und widersprüchlicher, aber ein Prozess, der jede Mühe lohnt. Sicher ist dabei nur eins: Diejenigen Stimmen, die behaupten, sie wüssten genau, was zu tun ist und fordern, es müssten nur die richtigen Maßnahmen ergriffen werden, um für klare (meist sind es die alten) Verhältnisse zu sorgen, machen es sich leicht.
Tipp: Dieser Film von ufuq.de unterstützt die pädagogische Praxis im Umgang mit unterschiedlichen Formen von Diskriminierung.
© Bildnachweis: KI-generiertes Bild mit Midjourney