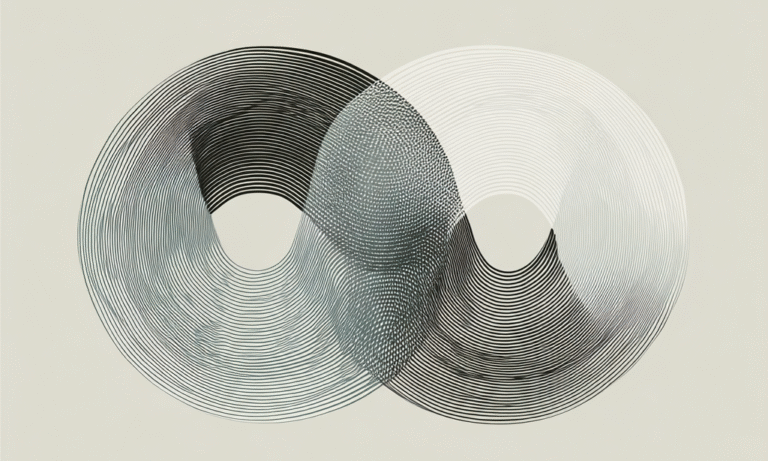Der deutsche Diskurs um „israelbezogenen“ Antisemitismus ist nicht nur kontrovers, sondern in besonderer Weise sensibel. Das zwingt uns, genauer hinzuschauen. So sind zum Beispiel nicht alle israelfeindlichen Positionen antisemitisch und nicht jede antisemitische Position von Muslim*innen ist islamistisch. Ein Diskurs, der dies vermittelt, wirkt strukturell rassistisch. Auch deswegen gilt es, Räume zu schaffen, in denen Konflikt und Kontroverse gelingen können.
Seit dem 7. Oktober 2023 hat die Anzahl antisemitischer Übergriffe unterschiedlichster Art weltweit zugenommen. Im Fokus der Kritik am Antisemitismus stehen dabei die Proteste gegen den Gazakrieg. Bei der Verurteilung der unterschiedlichen Positionen zwischen „Israelkritik“ und Antisemitismus macht es sich die mediale und politische Öffentlichkeit allerdings oft zu einfach – etwa wenn Antisemitismus und Islamismus gleichgesetzt werden. So wird die Verbreitung von Antisemitismus unterschätzt, wenn er lediglich auf Islamismus reduziert wird. Außerdem werden Palästinenser*innen, Araber*innen und Muslim*innen stigmatisiert, wenn vom einen aufs andere geschlossen und ihnen dabei beides unterstellt wird.
Delegitimierung führt zu Schweigen
Ein Beispiel: Wenn die islamistische und zum Spektrum der in Deutschland wegen Antisemitismus verbotenen Hizb-ut-Tahrir (HuT) zählende Organisation Muslim Interaktiv zu Demonstrationen gegen Israel und für ein „freies Palästina“ aufruft, das überdies „frei“ sein möge von „deutscher Schuld“, dann kommen – wie etwa in Hamburg oder Essen – schon mal einige tausend Teilnehmer*innen zusammen. Allerdings dürfte es sich bei der Mehrheit der hier meist palästinensischen, arabischen oder/und muslimischen Menschen, die ihre Emotionen, Perspektiven, Positionen und Forderungen auf die Straße tragen, nicht um Anhänger *innen der islamistischen Ideologie der Veranstalter handeln. Von der Agenda der Hizb-ut-Tahrir – etwa der Idee eines weltweiten Kalifats – weiß vermutlich ein Großteil der Demonstrierenden wenig und sie wollen davon auch gar nichts wissen. Will heißen: ‚Nur‘ weil jemand auf die Demonstration einer islamistischen Organisation gegen Israel oder israelische Politik geht, vertritt die Person deshalb nicht unbedingt islamistische oder antisemitische Positionen. Viele dürften in erster Linie einen Raum und eine Umgebung suchen, die es ihnen ermöglicht, ihre Gefühle und Perspektiven öffentlich auszudrücken.
Und selbst wenn viele der Teilnehmer*innen nicht nur die Politik Israels kritisieren, sondern den Staat Israel hassen und sich wünschen, er möge verschwinden, ist damit nicht zwangsläufig ein antisemitisches Weltbild verbunden. So läuft es zwar mir – und vielen Israelis und Jüdinnen und Juden noch mehr – kalt den Rücken herunter, wenn auf „Palästina-Demos“ unterschiedlicher Couleur „Burn Israel burn“ skandiert wird und israelische Fahnen in Flammen stehen. Feinde und Feindbilder zu haben, kann – etwa aus pädagogischer, politischer und mitunter auch aus polizeilicher Perspektive – ‚problematisch‘ und ein berechtigter Anlass zur Intervention sein. Aber ‚nur‘ weil es gegen Israel geht und es sich um eine Demonstration der HuT handelt, sind derartige Parolen, Positionen und Aktionen nicht zwangsläufig antisemitisch und/oder islamistisch.
Vielmehr tragen eine pauschale Delegitimierung und Abwertung des Protests sowie seiner Akteur*innen und Positionen zu einer „Entthematisierung“ des real existierenden Konflikts und seines Kontextes bei. Es ließe sich auch hier mitunter von einer mehr oder weniger bewussten ‚Umwegkommunikation‘ (oder besser: Nichtkommunikation) sprechen: Wenn nämlich kontroverse palästinensische/arabische/muslimische (und postkoloniale) Perspektiven als antisemitisch und islamistisch ausgemacht und als solche aus dem öffentlichen Diskurs verbannt werden, dann muss (zumindest mit diesen Stimmen) über Israel und Palästina und die widersprüchliche und tragische Geschichte und Gegenwart des Konflikts nicht weiter gesprochen werden. Dabei sind Bewertung und Verurteilung von Positionen als „antisemitisch“ oder/und „islamistisch“ allein anhand einzelner Parolen und Schlagworte meist nicht möglich, schon gar nicht auf den ersten Blick. Erschwerend für solche ‚Bewertungen‘ und die Auseinandersetzung kommt hinzu, dass sich Kritik an ungleichen, ungerechten, diskriminierenden und gewaltvollen Verhältnissen eben auch im Kontext von Israel, von israelischer Politik und dem Nahostkonflikt mit deren ideologisch geprägter Interpretation verbinden kann: Nicht nur hier tritt Antisemitismus als illegitimer Ausdruck von verständlichem Schmerz, legitimem Protest und legitimer Wut in Erscheinung.
Aus dem Arabischen Nationalismus lernen …
Außerdem geht bei einer Engführung von Islamismus und Antisemitismus unter, dass die Verbreitung der Ideologie des modernen Antisemitismus, insbesondere in seiner Spielart des israelbezogenen Antisemitismus weder auf den Islam noch auf den Islamismus zurückgeht, sondern vielmehr auf den säkularen antikolonialen und sich antizionistisch verstehenden Arabischen Nationalismus. Dessen Gefolge umfasst – etwa im Libanon – auch Teile der christlichen Bevölkerung in der Region. Seit spätestens den 1950er-Jahren ist der Arabische Nationalismus integraler Teil der Alltags- und Medienkultur und prägt bis heute viele politische Diskurse. Erst mit der Niederlage im Sechstagekrieg und dem Niedergang des Arabischen Nationalismus seit den 1970er-Jahren beerbten die verschiedenen islamistischen Strömungen diesen als Befreiungsideologie. Das bedeutet auch, dass antisemitische Stereotype und antisemitische Welterklärungen heute weit über die Anhänger islamistischer Ideologien und Organisationen hinaus verbreitet sind.
Diese wiederum bedienen sich in ganz unterschiedlicher Weise antisemitischer Ideologeme. Das gilt etwa für so unterschiedliche Organisationen wie Al-Qaida und den IS, die Hisbollah und Organisationen der Muslimbruderschaft wie der Hamas, die weltweit agierende Hizb-ut-Tahrir oder Parteien und Strömungen in der Sahelzone, Zentralasien, Indonesien, Malaysia oder der Türkei – ganz zu schweigen von den zahllosen Predigern und Influencer*innen in Sozialen Medien. Was sie vereint: Viele von ihnen nutzen regelmäßig Israel und den Nahostkonflikt in dem Bestreben, Muslim*innen als Opfer weltweiter Machenschaften für die eigene Sache zu mobilisieren. Und sie können dabei – meist ohne sich explizit darauf zu berufen – an ein bei vielen Muslim*innen tief verwurzeltes religiöses Wissen anknüpfen, das wie im Christentum in der einschlägigen Interpretation religiöser Quellentexte wurzelt, die sich gegen Juden richten. Dieser traditionelle, islamische Antijudaismus ist weit verbreitet und kann sich – wie die Beispiele von Hamas, der Hisbollah oder der iranischen Staatspropaganda zeigen – auch auf deutschen Straßen mit antizionistischem und antisemitischem Weltbild und antimodernem Verschwörungsdenken verbinden.
… heißt, Antisemitismus besser zu verstehen
Klingt kompliziert? Ist es auch. Aber gerade weil die Perspektiven auf den Konflikt so unterschiedlich, vielschichtig und widersprüchlich sind, sollte der Diskurs weniger von simplen Zuschreibungen und Besserwissen als von Zuhören und von Reflexion der jeweils eigenen Perspektive geprägt sein, nicht zuletzt um pauschale und rassistische, zumindest aber Rassismus fördernde, Stigmatisierungen zu verhindern. Denn wie mögen sich etwa viele Kinder und Enkel palästinensischer Familien fühlen, wenn sie bei einer HuT-Demonstration auf die Erfahrungen und Perspektiven „ihrer Leute“ verweisen wollten und ihnen in Deutschland deshalb – so würden sie es sehen – Antisemitismus UND Islamismus vorgeworfen wird? Sie finden sich mit ihren Emotionen und ihren Anliegen als Parias wieder und noch mehr außen vor, als sie es vielleicht schon vorher waren.
Das alles heißt keinesfalls, die teils frappierend gleich lautenden aber ebenfalls heterogenen Erfahrungen, Perspektiven und Ängste vieler israelischer und/oder jüdischer Menschen in Deutschland zu ignorieren; und es heißt keinesfalls, Israelhass und irgendeine Form von Antisemitismus hinzunehmen. Es heißt aber, genau hinzuhören und in Politik, Medien und Schulen der Migrationsgesellschaft Räume für Schmerz, Wut, Protest und kontroverse Perspektiven zu öffnen. Hier können dann auch Antisemitismus, Rassismus und andere Formen von Menschenfeindlichkeit benannt und ihnen begegnet werden. Sonst nehmen sich andere diese Räume und verbreiten ihre Antworten.
© Bildnachweis: KI-generiertes Bild mit Midjourney
Dieser Beitrag erschien zuerst in der Zeitschrift iz3w im Rahmen des Themenschwerpunktes „Im neuen Gewand – Islamismus“ (Ausgabe Mai/Juni 2025). Wir danken den Herausgeber*innen und dem Autor für die Erlaubnis, den Beitrag hier wiederzuveröffentlichen.