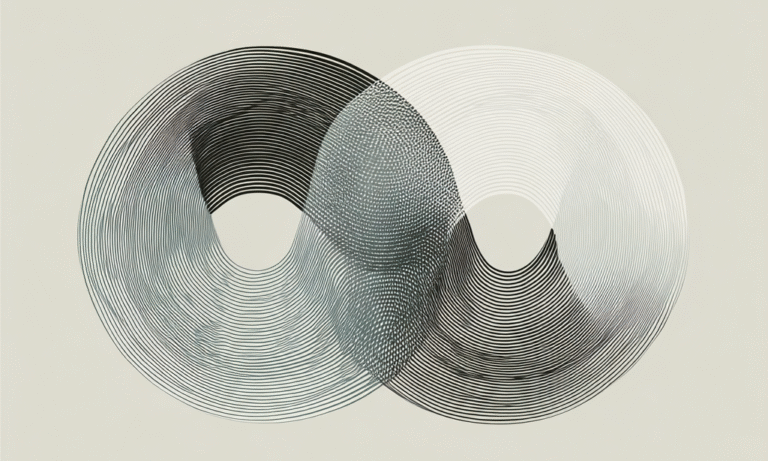Die Entwicklungen in Gaza und Israel werfen auch im Unterricht weiterhin schwierige Fragen auf. Wie kann pädagogisches Handeln in der aktuellen Situation gelingen? Prof. Dr. Karim Fereidooni hat seine 2024 veröffentlichten „50 Handlungsmöglichkeiten für Lehrer*innen“ überarbeitet – wir stellen sie vor.
Dieser Text ist eine überarbeitete Version des Textes „Hamas-Terror, Gaza-Krieg, Nahost-Konflikt. 50 Handlungsmöglichkeiten für Lehrer*innen“, der am 07.03.2024 zum ersten Mal veröffentlicht wurde und mittlerweile in acht unterschiedlichen Publikationsorten zu finden ist.[1] Angesichts der Entwicklungen in Gaza und Israel habe ich es für notwendig befunden, diese Handlungsempfehlungen zu überarbeiten.[2]
Ich akzeptiere Möglichkeiten und Leerstellen des Unterrichts
1. Ich stelle mich der Situation und schweige nicht über den Hamas-Terror vom 07.10.2023, bei dem über 1.200 (zumeist jüdische) Menschen ermordet worden sind und 253 jüdische Israelis nach Gaza entführt wurden. 28 Geiseln haben die Geiselhaft nicht überlebt. Die letzten 20 lebenden Geiseln wurden am 13.10.2025 freigelassen.[3] Überdies stelle ich mich der Situation und schweige nicht über das systematische Aushungern der palästinensischen Bevölkerung in Gaza, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit[4] durch die gezielten Vertreibungen von Millionen Palästinenser*innen, die Tötung von über 67.000 Palästinenser*innen in Gaza[5], sowie die Unverhältnismäßigkeit der Kriegsführung und das Verüben von Kriegsverbrechen[6] durch die rechtsextremistische Regierung Netanjahu und die israelische Armee. Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, Human Rights Watch, die beiden israelischen Nichtregierungsorganisationen B’Tselem und Physicians for Human Rights Israel sowie der UN-Menschenrechtsrat[7] bezeichnen das Vorgehen der rechtsextremistischen israelischen Regierung Netanjahu und der israelischen Armee als Genozid gegen die palästinensische Bevölkerung. Dies muss im Unterricht thematisiert werden. Zudem thematisiere ich in meinem Unterricht den Nahost-Konflikt.
2. Ich habe nicht den Anspruch, in einer einzigen Unterrichtsstunde die in Punkt 1 genannten komplexen Geschehnisse und Zusammenhänge erklären zu wollen.
3. Ich bereite mich emotional auf den Unterricht vor. Ich rede mit meinen Schüler*innen über meine und ihre Gefühle. Ich halte es aus, wenn meine Schüler*innen über Geiselnahme, Leid, Trauer, Vertreibung und Tod sprechen.
4. Ich versuche meine Schüler*innen anzuregen, Fragen zu den o.g. komplexen Geschehnissen und Zusammenhängen zu stellen, die ich im Nachgang (mit einer gewissen Vorbereitungszeit) versuche zu beantworten.
5. Ich gebe zu, wenn ich Sachverhalte (noch) nicht erklären kann.
6. Ich bereite mich fachlich auf den Unterricht vor. Ich nehme mir die Zeit, um die Vielschichtigkeit dieses Komplexes zu durchdringen. Dafür lese ich Bücher[8], nehme an Vorträgen und Workshops teil.
7. Ich nutze u.a. Bildungsmaterialien von ufuq.de, der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA) oder von Amina Nolte und Sophia Müller,[9] um Antworten auf die Fragen meiner Schüler*innen zu finden. Ich bin mir aber bewusst, dass ich einige Dinge nicht erklären kann.
Ich nutze schulische und außerschulische Unterstützungsangebote
8. Ich fordere Hilfe von meiner Schulleitung und von meinen Kolleg*innen ein, damit ich in meinen Bemühungen nicht alleine gelassen werde, die in Punkt eins genannten Geschehnisse und Zusammenhänge zu thematisieren. Ich als Teil meiner Fachkonferenzen überlege gemeinsam mit meinen Kolleg*innen, wie wir uns den in Punkt eins dargestellten Sachverhalten aus fachlicher und überfachlicher Perspektive nähern können.
9. Ich als Teil der Schulgemeinde rege an, dass wir eine Projektwoche zu diesem Themenkomplex durchführen. Für diesen Tag laden wir externe Referent*innen ein, z.B. von Pro Peace (ehemals Forum ziviler Friedensdienst).[10]
10. Ich setze mich dafür ein, dass bei zukünftigen Pädagogischen Tagen Referent*innen eingeladen werden, die sich mit Demokratiebildung und Menschenfeindlichkeit beschäftigen, um von diesen Menschen zu lernen.
11. Ich kooperiere mit außerschulischen Partner*innen z.B. Meet a Jew, Muslimische Akademie Deutschland, Trialog von Shai Hoffmann und Jouanna Hassoun, Schulpsychologischer Dienst, Systemberatung Extremismusprävention, Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus.
12. Ich führe regelmäßig kollegiale Fallberatungen mit meinen Kolleg*innen durch und melde mich für Supervision an, weil ich anerkenne, dass ich die Probleme meines Arbeitsalltags nicht alleine bewältigen kann.
13. Ich setze mich dafür ein, dass multiprofessionelle Teams an unserer Schule Wirklichkeit werden und ich arbeite daran mit, dass ein Konzept der Zusammenarbeit der unterschiedlichen Professionen entwickelt wird.
Ich nehme die Multiperspektivität des Nahost-Konflikts ernst
14. Ich thematisiere im Unterricht die gegenseitigen Verletzungsverhältnisse der letzten 80 Jahre dieses Konflikts in ihrer Multiperspektivität. Ich schiebe keiner Seite die alleinige Verantwortung/Schuld für den Nahost-Konflikt zu.
15. Ich verurteile das systematische Aushungern der palästinensischen Bevölkerung in Gaza, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die gezielten Vertreibungen von Millionen Palästinenser*innen, die Tötung von über 67.000 Palästinenser*innen in Gaza, die Unverhältnismäßigkeit der Kriegsführung und das Verüben von Kriegsverbrechen durch die rechtsextremistische Regierung Netanjahu und die israelische Armee. Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, Human Rights Watch, die beiden israelischen Nichtregierungsorganisationen B’Tselem und Physicians for Human Rights Israel sowie der UN-Menschenrechtsrat bezeichnen das Vorgehen der rechtsextremistischen israelischen Regierung Netanjahu und der israelische Armee als Genozid gegen die palästinensische Bevölkerung. Gleichzeitig verurteile ich den Terrorismus, der am 7.10.2023 durch die Hamas stattgefunden hat, sowie den alltäglichen Terror, den die Familien und Freund*innen der getöteten Hamas-Geiseln tagtäglich durchleben.
16. Ich halte es aus, wenn meine Schüler*innen unterschiedliche Perspektiven in den Unterricht hineintragen, die mit den universellen Menschenrechten vereinbar sind.
17. Ich zeige Haltung gegen Menschenfeindlichkeit und lege klar dar, dass Gewalt gegen Menschen in diesem Konflikt kein (antikolonialer) Widerstandsakt ist.
18. Ich versuche meinen Schüler*innen demokratische Werte beizubringen und schweige nicht, wenn menschenfeindliche Positionen dargestellt werden. Ich bin nicht neutral, wenn menschenfeindliche Meinungen vertreten werden. Dazu gehört u.a., dass ich mit meinen Schüler*innen über Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus spreche.
19. Ich setze mich im Unterricht für das Existenzrecht Israels ein und gleichzeitig thematisiere ich die völkerrechtswidrige Annektierung von Teilen des palästinensischen Westjordanlands durch Israel.[11]
20. Ich nutze u.a. die Dokumentationen über Daniel Cohn-Bendit,[12] sowie das Auslandsjournal Extra mit Meron Mendel,[13] um meinen Schüler*innen die Vielfältigkeit der israelischen Gesellschaft darzustellen, sowie den Spielfilm Gaza Surf Club,[14] um die Pluralität der palästinensischen Gesellschaft zu skizzieren. Zudem nutze ich die Dokumentation „Die Akte Netanjahu“, um Netanjahus Unterstützung zur Finanzierung der Hamas zu thematisieren.[15] Der israelische Ministerpräsident Netanjahu hat die Hamas im Gaza-Streifen und die Fatah im Westjordanland unterstützt, damit sich die Palästinenser*innen nicht gegen ihn vereinen.
21. Ich spreche mich im Unterricht dafür aus, dass Palästinenser*innen das Recht auf einen eigenen Staat haben und gleichzeitig thematisiere ich, dass die Ermordung von jüdischen Menschen keine antikoloniale Widerstandshandlung ist. Im Sinne des Kontroversitätsgebots des Beutelsbacher Konsenses[16] thematisiere ich im Unterricht die Argumente, die dafürsprechen und die Argumente, die dagegensprechen, dass Israel ein System der Apartheid in Israel, Gaza und im Westjordanland etabliert hat. Das Kontroversitätsgebot des Beutelsbacher Konsenses, welches als eine Art Berufsethos für Politik- und Geschichtslehrkräfte gilt, verlangt, dass politische Sachverhalte, die in Gesellschaft und Politik kontrovers diskutiert werden, ebenso im Unterricht kontrovers dargestellt werden müssen, damit die Schüler*innen ein eigenständiges politisches Urteil fällen können:
Argumente, die dafürsprechen, dass Israel ein System der Apartheid eingeführt hat:
- Unterschiedliche Rechtssysteme im Westjordanland: Israelis unter Zivilrecht (Ziel: gerechter Interessenausgleich), Palästinenser unter Militärrecht (Ziel: Sicherung der militärischen Ordnung).[17]
- Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Palästinenser*innen u.a. in Gaza und im Westjordanland durch Checkpoints und Sperranlagen.
- Ungleicher Zugang zu Land und Ressourcen, besonders Wasser und Infrastruktur u.a. im Westjordanland für jüdische Siedler*innen und Palästinenser*innen.
- Nationalstaatsgesetz Israels betont die Selbstbestimmung exklusiv für das jüdische Volk und exkludiert damit muslimische und christliche Palästinenser*innen.
Argumente, die dagegensprechen, dass Israel ein System der Apartheid eingeführt hat:
- Es gibt palästinensischstämmige Richter an Gerichten in Israel und arabische Parteien im israelischen Parlament.
- Palästinensische Israelis besitzen die israelische Staatsbürgerschaft und das Wahlrecht.
- Check-Points und Sperranlagen wurden als Sicherheitsmaßnahmen, also als Reaktion auf palästinensischen Terrorismus etabliert.
- Der sogenannte Nahost-Konflikt ist ein national-territorialer Konflikt um Land und nicht ein religiöser bzw. rassifizierter Konflikt.
Um diese Frage in meinem Unterricht zu thematisieren, nutze ich u.a. Textauszüge[18] aus dem folgenden Text (Deutschlandfunk 2024):[19] Zunächst verwende ich die juristische Definition von Apartheid: „Der Begriff Apartheid (…) fußt auf drei Elementen. Zum einen muss es unmenschliche Handlungen geben, beispielsweise Freiheitsberaubung, Eigentumszerstörung oder Folter. Zweitens muss ein institutionalisiertes Regime eine rassische Gruppe unterdrücken, wobei der Begriff Rasse umstritten ist. Drittens hegen die Täter die Absicht, die Apartheid zu fördern und zu erhalten“.
Danach stelle ich unterschiedliche Positionen vor:
Position a): Es lasse sich kaum abstreiten, dass es in den von Israel kontrollierten Gebieten ein institutionalisiertes und auf Dauer angelegtes System der Diskriminierung gebe, erklärt die Politologin Muriel Asseburg von Stiftung Wissenschaft und Politik. Damit verbunden seien eine systematische Unterdrückung der Palästinenser*innen sowie unmenschliche Handlungen.
Position b): Es kann Apartheid sein, aber es muss nicht Apartheid sein, sagt der Rechtswissenschaftler Kai Ambos, Professor für Internationales Strafrecht und Völkerrecht an der Universität Göttingen. Der Internationale Gerichtshof werde das klären. Das Verfahren könne aber Jahre dauern, denn es sei sehr anspruchsvoll, den Vorwurf der Apartheid zu beweisen. In objektiver Hinsicht können wir sagen, dass das, was im Westjordanland passiert, die Merkmale eines Apartheidregimes hat (…) in dem Sinne, dass die palästinensische indigene Bevölkerung gegenüber der zugezogenen Siedlerbevölkerung aus Israel diskriminiert wird. Der Jurist verweist zudem auf ein duales Rechtsregime, was sehr typisch für Apartheid ist. So gebe es einerseits israelisches nationales Recht, was auf die [israelischen] Siedler [im Westjordanland] anwendbar ist, anderseits existiere Besatzungsrecht. Knackpunkt ist laut Ambos das Element der rassistischen Unterdrückung: Die Frage ist, ob man auch von einer rassisch begründeten Gruppendominanz sprechen kann, wenn es vielleicht im Kern nicht um die Rasse, also Rassismus geht, sondern zum Beispiel um Land und wer einen Anspruch darauf hat. Das ist sehr umstritten.
Des Weiteren nutze ich die folgenden Textauszüge (ZDF Heute 2024)[20]:
Position c): Es gibt gute Gründe, die dafürsprechen, dass Elemente des Apartheidtatbestandes vorliegen, aber auch gute Gründe, dass der Fall in den besetzten palästinensischen Gebieten anders gelagert ist. Ein Unterschied etwa zum Apartheid-Regime in Südafrika liege darin, dass die Ungleichbehandlung von Palästinenser*innen nicht innerhalb Israels stattfindet, sondern Israel als Besatzungsmacht handele. In einer Besatzungssituation dürfe der Besatzer die Angehörigen der Besatzungsmacht [Israelis, K.F.] grundsätzlich anders behandeln als die Bevölkerung des besetzten Gebietes [Palästinenser*innen im Westjordanland, K.F.]. Andererseits ist Israel aber keine reine Besatzungsmacht, sondern hat im Laufe der letzten Jahrzehnte 700.000 Siedler unter anderem im Westjordanland völkerrechtswidrig angesiedelt. Auch gegenüber diesen [israelischen, K.F.] Siedlern wird die einheimische [palästinensische, K.F.] Bevölkerung diskriminiert, wenn etwa bestimmte Straßen nur für Israelis geöffnet sind. Nicht jede solche Diskriminierung führt aber zu Apartheid. Entscheidend, so Völkerrechtler Stefan Talmon, sei der Zweck der Maßnahmen: Geht es um eine auf Rassentrennung und -diskriminierung beruhende Herrschaft der Israelis über die palästinensische Bevölkerung und deren systematische Unterdrückung oder um Sicherheitsinteressen [der israelischen Bevölkerung, K.F.]? Es ist eine komplizierte Mischlage, bilanziert Talmon mit Blick auf die palästinensischen Gebiete – jede Maßnahme müsse einzeln bewertet werden. Der Teufel steckt im Detail, pauschal zu behaupten, Israel betreibe Apartheid, wird der komplexen Lage nicht gerecht.
Position d): Am 19. Juli 2024 hat der Internationale Gerichtshof ein Rechtsgutachten zur israelischen Besatzungspolitik vorgelegt. Darin nimmt das Gericht auch eine Verletzung von Artikel 3 des Internationalen Übereinkommens gegen Rassendiskriminierung durch Israel an. Artikel 3 des Übereinkommens verpflichtet die Vertragsstaaten, Praktiken der Segregation und Apartheid in ihren Hoheitsgebieten zu verhindern, zu verbieten und auszumerzen. Völkerrechtler wie der Göttinger Professor Kai Ambos (…) werten dies als Anerkennung des Vorwurfs der Apartheid.
Schließlich verwende ich den folgenden Textauszug (Stiftung Wissenschaft und Politik 2022):[21]
Position e): In einer repräsentativen Umfrage unter der jüdischen Wahlbevölkerung in den USA stimmten 2021 25 Prozent der Befragten der Aussage zu, Israel sei ein Apartheid-Staat. (…) Die [deutsche, KF] Bundesregierung sollte sich den Apartheid-Vorwurf vor einer sorgfältigen Prüfung durch die zuständigen Organe weder zu eigen machen noch ihn abtun. Sie sollte den AI-Bericht[22] aber als Weckruf verstehen, gravierende Menschenrechtsverletzungen nicht länger als eine Normalität hinzunehmen, und die andauernde Besatzung nicht als einen Zustand zu betrachten, der losgelöst von einem »demokratischen Israel« existierte.
22. Ich lege im Unterricht dar, dass Palästinenser*innen in Gaza bereits mehrfach vor und nach dem 7.10. gegen die Hamas demonstriert haben[23] und ich thematisiere, dass ca. die Hälfte der Bevölkerung von Gaza jünger als 19 Jahre ist. Ich lege dar, dass nur ein Bruchteil der heute in Gaza lebenden Menschen bei den letzten Wahlen im Jahr 2006 die Hamas gewählt hat.[24]
23. Ich thematisiere, dass Amnesty International, Ärzte ohne Grenzen, Human Rights Watch, die beiden israelischen Nichtregierungsorganisationen B’Tselem und Physicians for Human Rights Israel sowie der UN-Menschenrechtsrat[25] das Vorgehen der rechtsextremistischen israelischen Regierung Netanjahu und der israelische Armee als Genozid gegen die palästinensische Bevölkerung betrachten und im Zuge dessen thematisiere ich die Aussagen des ehemaligen israelischen Verteidigungsministers Joav Gallant, der bis November 2024 im Amt war und Palästinenser*innen als „menschliche Tiere“ bezeichnet hat.[26]
Um im Unterricht darüber zu sprechen, ob es sich um einen Genozid[27] an der palästinensischen Bevölkerung handelt oder nicht, nutze ich die folgenden Textausschnitte (Tagesschau 2025)[28]:
Zunächst nutze ich die Definition von Völkermord der UN-Konvention über die Verhütung und Bestrafung von Völkermord. In dieser Konvention bedeutet Völkermord eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören:
Handlung a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe
Handlung b) Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe
Handlung c) Vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen
Handlung d) Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind
Handlung e) Gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe.
Im Sinne des Kontroversitätsgebots des Beutelsbacher Konsenses thematisiere ich im Unterricht die Argumente, die dafürsprechen und die Argumente, die dagegensprechen, dass Israel einen Genozid in Gaza verübt (hat). Das Kontroversitätsgebot des Beutelsbacher Konsens, welches als eine Art Berufsethos für Politik- und Geschichtslehrkräfte gilt, verlangt, dass politische Sachverhalte, die in Gesellschaft und Politik kontrovers diskutiert werden, ebenso im Unterricht kontrovers dargestellt werden müssen, damit die Schüler*innen ein eigenständiges politisches Urteil fällen können[29]:
Argumente, die dafürsprechen, dass Israel einen Genozid in Gaza durchgeführt hat:
- Handlungen a) und b): Seit dem 07.10.2023 wurden mehr als 67.000 Palästinenser*innen von der israelischen Armee getötet. 30 % der direkten Toten sind Kinder unter 18. Dies kann als die gezielte Vernichtung der Palästinenser*innen verstanden werden.
- Handlung c) Die systematische Zerstörung von Kliniken, Anlagen des täglichen Bedarfs (wie z.B. Wasser) und Schulen durch die israelische Armee. Dies führt dazu, dass das Überleben der Zivilbevölkerung massiv gefährdet ist.
- Handlung c) Das gezielte Aushungern der palästinensischen Bevölkerung in Gaza, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die gezielten Vertreibungen von Millionen Palästinenser*innen, die Unverhältnismäßigkeit der Kriegsführung und das Verüben von Kriegsverbrechen durch die israelische Armee können als Mittel zur Vernichtung einer Bevölkerung verstanden werden.
- Verweis auf die Absicht, die Palästinenser*innen im Gaza Streifen ganz oder teilweise zu zerstören:
Beispielhaft sei zum einen die öffentliche Äußerung des ehemaligen israelischen Verteidigungsministers Joav Galant erwähnt, der bis November 2024 im Amt war, und Palästinenser*innen als „menschliche Tiere“ bezeichnet hat. Zum anderen sei auf die Äußerung der israelischen Ministerin May Golan am 07.10.2023 hingewiesen: “All of Gaza’s infrastructures must be destroyed to its foundation and their electricity cut off immediately. The war is not against Hamas but against the state of Gaza“.[30] - Südafrika hat Israel vor dem Internationalen Gerichtshof wegen mutmaßlichen Genozids verklagt und der Internationale Gerichtshof hat anerkannt, dass es eine plausible Gefahr eines Genozids gibt und Israel aufgefordert, Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Am 26. Januar [2024] entschied das Gericht unter anderem: Zumindest einige Handlungen und Unterlassungen, die durch Israel in Gaza begangen wurden, scheinen unter die Vorschriften der Genozid-Konvention fallen zu können.[31]
Argumente, die dagegensprechen, dass Israel einen Genozid in Gaza durchgeführt hat:
- Es wird bezweifelt, dass die Absicht der rechtsextremen Regierung Netanjahu und der israelischen Armee zur Auslöschung der gesamten palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen klar bewiesen werden kann.
- Die rechtsextreme Regierung Netanjahu und die israelische Armee berufen sich darauf, die Hamas zu zerstören und nicht die Vernichtung des palästinensischen Volkes betreiben zu wollen.
- Das Selbstverteidigungsrecht Israels gegen die Terrororganisation Hamas sollte nicht als Genozid ausgelegt werden.
- Die israelische Armee hat vor vielen Angriffen in Gaza Warnungen ausgesprochen und sogenannte Schutzzonen für die Palästinenser*innen eingerichtet.[32]
Im Unterricht nutze ich diesen Textausschnitt[33] (Bock/Ambos 2025):[34]
Position a) „Es spricht viel dafür, dass die Auswirkungen der israelischen Kriegsführung auf die palästinensische Gruppe so massiv sind, dass darin Verletzungen des humanitären Völkerrechts (…) zu sehen sind. Dies begründet nach unserer Überzeugung den Vorwurf der Kriegsverbrechen. Zudem wird man von einem systematischen und ausgedehnten Angriff auf die Zivilbevölkerung ausgehen können, so dass auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Betracht kommen. In diese Richtung gehen derzeit auch die Ermittlungen des Internationalen Strafgerichtshofs. In Gaza geschieht also schwerstes völkerrechtliches Unrecht, hervorgerufen durch die israelische Kriegsführung. Wer gleichwohl darüber hinaus auch von Genozid sprechen will, muss beweisen, dass es sich bei dem Vorbringen Israels um Schutzbehauptungen handelt und tatsächlich die Gruppe der Palästinenser als solche das eigentliche Ziel der Gewaltakte ist“.[35]
Des Weiteren nutze ich den folgenden Textauszug (Interview des Journal für Internationale Politik und Gesellschaft mit Prof. Dr. Omer Bartov, Professor für Holocaust- und Völkermordstudien an der Brown University, USA):[36]
Interviewer: „Kommen wir zurück zur juristischen Dimension. Im Zentrum der Definition von Genozid steht die Absicht zur Zerstörung. Wie lässt sich diese Absicht beweisen? Andere sagen: Das sei nur Rhetorik oder Taktik gegen Hamas. Wie sehen Sie das?“
Position b): Bartov: „Natürlich ist es schwierig, eine genozidale Absicht nachzuweisen. Man braucht zwei Dinge: Entweder explizite Aussagen oder ein deutliches Operationsmuster. Die meisten Regierungen, die Genozid begehen, sagen nicht: „Wir führen einen Genozid durch.“ Sie sagen: „Es gibt eine Sicherheitsbedrohung“, „das sind Feinde“, „wir müssen uns verteidigen“. Sie verwenden beschönigende Begriffe – insbesondere das Wort „Krieg“. Aber spätestens seit Mai 2024 gibt es in Gaza keinen Krieg mehr. Der Begriff „Krieg“ ist selbst ein Euphemismus – genau wie die „humanitäre Stadt“ in Rafah, die in Wirklichkeit ein Konzentrationslager ist. Die israelische Armee zerstört Gaza systematisch – Tag für Tag. Häuser werden mit schwerem Gerät abgerissen, beauftragt und bezahlt von israelischen Firmen.“
Schließlich nutze ich die beiden folgenden Textauszüge (Lehnstaedt 2025)[37] und (Swoboda 2024)[38]
Position c): „Ein Schuldspruch [bezüglich des Genozids, K.F.] erfolgt (…) in einem Gerichtsverfahren mit Beweisen und auch mit einer Verteidigung. Persönliche Meinungen, wie und was ein Genozid sein könnte, sind eben das: Glauben statt Wissen.“[39]
Position d): „Aus meiner Sicht ist der Tatbestand des Völkermords nicht erfüllt, weil die Völkermordabsicht nicht das einzig plausible Motiv für die Gewalt ist. Israel begründet seine Angriffe im Gaza-Streifen mit dem Recht auf Selbstverteidigung und mit dem Ziel, die Geiseln zu befreien. Das ist im Völkerrecht erlaubt, wenn auch vielleicht in engeren Grenzen, als Israel es derzeit macht. (…) Es ist schon schwer, einzelnen Personen eine Völkermordabsicht nachzuweisen; für staatliches Handeln ist es noch schwerer. (…) Es ist sehr wahrscheinlich, dass Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Gaza begangen wurden. Völkermord wird in der öffentlichen Wahrnehmung oft als das schwerstmögliche Verbrechen angesehen. Juristisch betrachtet sind aber alle Kernverbrechen von gleicher Schwere. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit kommen häufiger vor und sind leichter nachzuweisen. Meiner Wahrnehmung nach ist der Begriff Völkermord juristisch mittlerweile zur Last geworden.“[40]
Ich stelle menschliche Schicksale vor, anstatt Opferzahlen zu präsentieren
24. Ich befördere die Empathiefähigkeit meiner Schüler*innen, indem ich die individuellen Schicksale auf israelischer und palästinensischer Seite beleuchte, damit die Schüler*innen die menschlichen Schicksale hinter der großen Zahl der Getöteten kennenlernen. Ich achte darauf, dass Schüler*innen mit familiären oder biografischen Bezügen zu Israel oder Palästina nicht zu „Expert*innen“ oder „Zeitzeug*innen“ gemacht werden. Ich erkenne ihre Erfahrungen an, ohne sie zu instrumentalisieren. Ich entwickle gemeinsam mit meinen Schüler*innen Regeln für kontroverse Diskussionen. Wir achten auf Redezeit, sprechen mithilfe von Ich-Botschaften und vermeiden jede Form von Kollektivschuldzuschreibung. Wir unterscheiden klar zwischen Kritik an politischen Akteur*innen und Feindseligkeit gegenüber Gruppen von Menschen.
25. Ich thematisiere im Unterricht die Einzelschicksale beider Seiten. Ich gehe u.a. auf die Ermordung des palästinensischen Rettungssanitäters Awad Darawshe ein, der auf dem Supernova-Festival, welches am 7.10. von den Hamas-Terroristen angegriffen wurde, Dienst tat und durch die Terroristen umgebracht wurde. Ich thematisiere das Schicksal von Shachar, Shlomi und Rotem Mathias, um die Grausamkeit des Terrors des 7.10. behandeln zu können.[41]
26. Ich thematisiere das systematische Aushungern der palästinensischen Bevölkerung in Gaza, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit durch die gezielten Vertreibungen von Millionen Palästinenser*innen und die Tötung von über 67.000 Palästinenser*innen in Gaza, die Unverhältnismäßigkeit der Kriegsführung und das Verüben von Kriegsverbrechen durch die rechtsextremistische Regierung Netanjahu und die israelische Armee und zugleich informiere ich meine Schüler*innen über die Arbeit der Initiative „Bring Them Home Now“, die sich dafür eingesetzt hat, dass die israelischen Geiseln, die von der Hamas nach Gaza entführt wurden, freigelassen wurden und die die Angehörigen der getöteten Hamas-Geiseln psychisch unterstützt.
Ich stelle Initiativen vor, die sich für den Frieden einsetzen
27. Ich stelle meinen Schüler*innen Initiativen vor, die sich vor Ort für Frieden zwischen Israelis und Palästinenser*innen einsetzen: z.B. Standing Together, Women Wage Peace, Hands of Peace, School for Peace, Combatants for Peace und die jüdisch-muslimische Schule in Be’er Sheva.
28. Ich stelle meinen Schüler*innen Projekte vor, die sich in Deutschland und Österreich für Frieden einsetzen, z.B. Christlich-Islamisches Dialogforum Dortmund, Islamische Akademie NRW, Dialogperspektiven, Begegnen e.V. und die Mahnwachen für den Frieden.
Ich erläutere historische und geopolitische Zusammenhänge des Nahost-Konflikts
29. Ich stelle meinen Schüler*innen die historischen Zusammenhänge der Shoah dar und beleuchte u.a. die Rolle der christlichen Kirchen in der Zeit von 1933 bis 1945 und die Position des Großmufti von Jerusalem Mohammed Amin al-Husseini, der ein Anhänger Hitlers war und sich einige Mal mit ihm getroffen hat.
30. Ich präsentiere muslimische Persönlichkeiten, die in der Zeit von 1933-1945 jüdische Menschen vor der Deportation in die Konzentrationslager bewahrt haben, wie z.B. Si Kaddour Benghabrit, Abdul Hussain Sardari oder Mohammad Helmy.[42]
31. Ich thematisiere die geopolitischen Zusammenhänge hinter dem Nahost-Konflikt und gehe u.a. auf die historische Rolle des englischen Kolonialismus von Palästina und die Vertreibung von ca. 700.000 bis 750.000 Palästinenser*innen zwischen 1947 und 1949 im Zuge der Teilungspläne Palästinas durch die Vereinten Nationen ein.[43] Viele dieser geflüchteten Palästinenser*innen leben in Jordanien, im Libanon und in Syrien, wo sie am gesellschaftlichen Rand leben. Inzwischen beträgt die Anzahl der palästinensischen Geflüchteten 3,47 Millionen. Zugleich thematisiere ich, dass nach der Staatsgründung Israels von den fast 900.000 Jüd*innen und Juden, die in mehrheitlich muslimisch geprägten Staaten (wie z.B. Irak, Iran, Marokko, Tunesien) gelebt haben, heutzutage nur noch einige wenige Tausend Jüd*innen und Juden übriggeblieben sind. Dies ist sowohl auf die freiwillige Ausreise nach Israel aber auch auf Fluchtmigration, Vertreibung und Ermordung von Jüd*innen und Juden in Folge von antisemitischen Pogromen zurückzuführen.[44]
32. Ich gehe auf den Regional-Konflikt zwischen Iran und Saudi-Arabien ein und thematisiere im Unterricht, dass Saudi-Arabien und Israel einen historischen Friedenvertrag miteinander schließen wollten, bevor die Hamas den Terror am 7.10.2023 verübt und israelische Geiseln entführt und getötet hat. Viele Beobachter*innen sind der Ansicht, dass Iran die Hamas unterstützt hat, den Terror des 7.10.2023 zu begehen, damit dieser Friedenschluss zwischen Israel und Saudi-Arabien nicht zustande kommt.
Ich entwickele Regeln des friedlichen Zusammenlebens für meine Schule
33. Ich habe nicht den Anspruch, den Nahost-Konflikt zu lösen. Vielmehr erarbeite ich mit meinen Schüler*innen gemeinsame Regeln des Miteinanders in unserer Klasse und in unserer Schule.
34. Ich arbeite gemeinsam mit meinen Schüler*innen daran, dass niemand Angst haben muss, in die Schule zu kommen.
35. Ich konzipiere Unterrichtsmaterialien mit meinen Kolleg*innen und meinen Schüler*innen, damit die Multiperspektivität des jüdischen und muslimischen Lebens in Deutschland sichtbar wird. Ich verzichte im Unterricht auf das Zeigen von ungeprüften Social-Media-Clips. Ich thematisiere stattdessen, wie schnell Bilder und Informationen in sozialen Medien manipuliert oder aus dem Kontext gerissen werden können, und trage damit zur Medienkompetenz meiner Schüler*innen bei. Ich achte darauf, dass in meinem Unterricht keine Kollektivurteile formuliert werden. In meinem Unterricht spreche ich nicht von „den Israelis“, von „den Juden“ oder „den Palästinenser*innen“ oder „den Muslim*innen“, sondern benenne politische Akteur*innen, Institutionen oder Ereignisse konkret, um pauschalisierende Zuschreibungen zu vermeiden.
Ich nehme Antisemitismus und antimuslimischen Rassismus ernst
36. Ich erkenne an, dass Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus in unserer Gesellschaft vorkommen und setze mich dafür ein, dass in unserer Schule beiden Ungleichheitsideologien gleichermaßen entgegengewirkt wird. Hierfür nutze ich u.a. die Erkenntnisse der Mitte Studie 2024/25[45] und den Bericht des Unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit.[46] Ich weiß, dass antimuslimischer Rassismus und Antisemitismus nach dem Prinzip „teile und herrsche“ funktionieren.
37. Ich spiele in meinem Unterricht Minderheiten (Juden/Jüd*innen und Muslim*innen) nicht gegeneinander aus.
38. Ich erkenne an, dass meine muslimischen Schüler*innen bzw. meine Schüler*innen, die als muslimisch wahrgenommen werden und die ggf. in meinem Unterricht Antisemitismus reproduzieren, von antimuslimischem Rassismus betroffen sind. Und ich erkenne an, dass meine jüdischen Schüler*innen bzw. meine Schüler*innen, die als jüdisch wahrgenommen werden und die ggf. in meinem Unterricht antimuslimischen Rassismus reproduzieren, von Antisemitismus betroffen sind.
39. Ich nutze antimuslimischen Rassismus nicht, um Antisemitismus zu bekämpfen. Und ich nutze Antisemitismus nicht, um antimuslimischen Rassismus zu bekämpfen.
Ich besitze eine realistische Sichtweise auf mein schulisches Handeln
40. Ich bin mir bewusst, dass Schüler*innen die demokratischen Werte unserer Gesellschaft vor allem in der Schule lernen.
41. Ich weiß, dass mein Unterricht für viele Schüler*innen der einzige Ort in ihrem Leben ist, in dem sie mit gegensätzlichen Meinungen konfrontiert werden.
42. Ich überschätze und unterschätze meine Rolle nicht.
43. Ich erkenne an, dass Lernen ein zirkulärer Prozess und kein linearer Prozess ist.
44. Ich weiß, dass Bildungsprozesse Zeit brauchen.
45. Ich erkenne an, dass meine Schüler*innen, die sich aktuell menschenfeindlich äußern, vielleicht in einigen Monaten oder Jahren dazulernen und sich von ihren menschenfeindlichen Positionen lösen; vielleicht aber auch nicht.
46. Ich verstehe, dass Schule ein Schutzraum für Schüler*innen ist, in dem Schüler*innen Entwicklungsmöglichkeiten haben müssen.
47. Ich erkenne an, dass Schüler*innen sich ausprobieren, mich provozieren und sich an meinen politischen Positionen reiben, um ihren Platz in unserer Gesellschaft zu finden. Ich setze mich Tag für Tag für die Bildung von jungen Menschen ein und begegne deshalb jungen Menschen respektvoll, auch wenn Sie mir diesen Respekt zeitweise nicht entgegenbringen.
48. Ich akzeptiere, dass ich als Lehrkraft eine Vorbildrolle in unserer Gesellschaft einnehme. Ich akzeptiere, dass ich einige meiner Schüler*innen mit meinen Bildungsangeboten nicht erreichen kann.
49. Ich realisiere, dass sich einige meiner Schüler*innen, trotz meiner Bemühungen, weiterhin menschenfeindlich äußern werden.
Ich gehe wertschätzend mit mir um
50. Ich mache mein persönliches Glück nicht vom Lernerfolg meiner Schüler*innen abhängig.
Die im Beitrag vorgestellten 50 Handlungsempfehlungen für Lehrer*innen von Prof. Dr. Karim Fereidooni stehen Ihnen hier auch als PDF zur Verfügung.
Fußnoten
[1] Siehe https://www.karim-fereidooni.de/publikationen/
[2] Ich danke Majula Jaiteh und Fatih Badahir Kaya für ihre wertvollen Hinweise im Zuge der Erstellung dieser Handlungsmöglichkeiten.
[3] https://www.stern.de/politik/ausland/hamas-geiseln–was-mit-den-frauen-aus-israel-passiert-ist-36129576.html
[4] „Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind schwere Verstöße gegen das internationale Völkerrecht, die durch systematische Angriffe gegen die Zivilbevölkerung gekennzeichnet sind. Sie zählen zu den Kernverbrechen des Völkerstrafrechts und unterliegen dem Weltrechtsprinzip. Zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit zählen z.B. Mord, ethnische Ausrottung, Versklavung und Deportation“. Abrufbar unter: https://www.ecchr.eu/glossar/verbrechen-gegen-die-menschlichkeit/)
[5] Wissenschaftler*innen sprechen von höheren Todeszahlen (https://www.sueddeutsche.de/politik/todeszahlen-gaza-zu-niedrig-israel-krieg-li.3275334 und https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2025.06.19.25329797v3.full). Der Bericht verweist darauf, dass mehr als 30 Prozent der direkten Toten Kinder unter 18 sind.
[6] Tötung, Geiselnahme, Folter und Vergewaltigung von Zivilbevölkerung und Kriegsgefangenen. Angriffe auf die Zivilbevölkerung, auf Krankenhäuser, Kirchen, Schulen, Universitäten und Denkmäler. Plünderungen und Zerstörung von Eigentum.
[7] Der Menschenrechtsrat hat 47 Mitglieder, die von der Generalversammlung für drei Jahre gewählt werden: 13 Sitze für afrikanische Staaten, 13 für asiatische und pazifische, 8 für lateinamerikanische und karibische, 6 für osteuropäische und 7 für westeuropäische und andere Staaten. Dem Menschenrechtsrat gehören auch nicht demokratische Staaten wie beispielsweise China, Kuba, Kuwait und Qatar an. In diesen Staaten werden Menschenrechte staatlicherseits gezielt verletzt.
[8] Zum Beispiel: Jouanna Hassoun und Shai Hoffmann (2024): Wie wir über Israel und Palästina sprechen.
[9] https://israelpalaestinavideos.org/bildungsmaterial/handreichung
[10] https://www.propeace.de/de
[11] Das Westjordanland ist seit Juni 1967 von Israel militärisch besetzt.
[12] https://www.youtube.com/watch?v=QWqZadU-fNc
[13] https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/doku-rueckkehr-nach-israel-100.html
[14] https://vimeo.com/ondemand/gazasurfclub
[15] https://www.ardmediathek.de/film/the-bibi-files-die-akte-netanjahu/Y3JpZDovL25kci5kZS80ODc4IHByb3BsYW5fMTk2Mzc1NzI5
[16] „I. Überwältigungsverbot. Es ist nicht erlaubt, den Schüler[*innen] – mit welchen Mitteln auch immer – im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der Gewinnung eines selbständigen Urteils“ zu hindern. (…) 2. Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muss auch im Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen, Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten. 3. Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine politische Situation und seine eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen“ (https://www.bpb.de/die-bpb/ueber-uns/auftrag/51310/beutelsbacher-konsens/).
[17] Das Militärrecht erlaubt längere Untersuchungshaft und eingeschränkten Zugang zu Anwälten, die im Zivilrecht nicht zulässig wären. Die Dauer der Untersuchungshaft ist bei Palästinenser*innen bis zu 96 Stunden ohne richterliche Vorführung möglich; bei Israelis maximal 24 Stunden.
[18] Diese Textauszüge dienen lediglich als Anschauungsbeispiele unterschiedlicher Perspektiven. Jede Lehrkraft muss eine eigene Textrecherche betreiben, um diese Unterrichtssequenz durchführen zu können.
[19] https://www.deutschlandfunk.de/apartheid-israel-klage-suedafrika-100.html
[20] Abrufbar unter: https://www.zdfheute.de/politik/ausland/palaestinenser-apartheid-vorwurf-israel-nahost-konflikt-100.html
[21] https://www.swp-berlin.org/10.18449/2022A13/
[22] Gemeint ist Amnesty International.
[23] https://www.spiegel.de/ausland/gaza-neue-proteste-gegen-hamas-angekuendigt-a-c5b818c4-372b-4049-b8b5-9eb219359852
[24] https://www.fr.de/politik/krieg-terror-israel-hamas-usa-wahlen-gazastreifen-westjordanland-iran-zr-92636387.html#google_vignette
[25] Der Menschenrechtsrat hat 47 Mitglieder, die von der Generalversammlung für drei Jahre gewählt werden: 13 Sitze für afrikanische Staaten, 13 für asiatische und pazifische, 8 für lateinamerikanische und karibische, 6 für osteuropäische und 7 für westeuropäische und andere Staaten. Dem Menschenrechtsrat gehören auch nicht demokratische Staaten wie beispielsweise: China, Kuba, Kuwait und Qatar an. In diesen Staaten werden Menschenrechte staatlicherseits gezielt verletzt.
[26] https://www.juedische-allgemeine.de/israel/gazastreifen-abgeriegelt-alle-lieferungen-eingestellt/
[27] Die Begriffe Genozid und Völkermord sind Synonyme.
[28] https://www.tagesschau.de/ausland/asien/israel-gaza-kommissionsbericht-un-100.html
[29] Bis der Internationale Gerichtshof sein Urteil in Bezug auf den Vorwurf des Genozids an den Palästinenser*innen in Gaza nicht gefällt hat, oder die Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft den Genozid als solches anerkannt hat, sollte im Unterricht, im Sinne des Kontroversitätsgebots des Beutelsbacher Konsens, auf die Argumente, die dafürsprechen und die Argumente, die dagegensprechen eingegangen werden. Denn in Bezug auf die Shoah oder Srebrenica ist eine pro/contra-Argumentation im Unterricht unrechtmäßig, weil diese Genozide als solche vor Gericht bzw. von der Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft akzeptiert worden sind.
[30] In diesem Bericht sind viele weitere Positionen israelischer Politiker*innen und Militärs dokumentiert, die auf die genozidale Absicht hinweisen: https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/jun/27/israel-gaza-propaganda
[31] https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/voelkerrecht-deutschland-israel-100.html
[32] In der Sendung Markus Lanz vom 30.09.2025 spricht die Psychologin Katrin Glatz Brubakk, die in Gaza gearbeitet hat, davon, dass diese vermeintlichen Schutzzonen von der israelischen Armee bombardiert wurden. Abrufbar unter: https://www.zdf.de/talk/markus-lanz-114
[33] Diese Textauszüge dienen lediglich als Anschauungsbeispiele unterschiedlicher Perspektiven. Jede Lehrkraft muss eine eigene Textrecherche betreiben, um diese Unterrichtssequenz durchführen zu können.
[34] Abrufbar unter: https://verfassungsblog.de/genozid-in-gaza/
[35] Prof. Dr. Kai Ambos ist Professor für Straf- und Völkerrecht an der Universität Göttingen und Richter am Kosovo Sondertribunal in Den Haag und Prof. Dr. Stefanie Bock ist Professorin für Strafrecht, Strafprozessrecht, Internationales Strafrecht und Rechtsvergleichung und Geschäftsführende Direktorin des Internationalen Forschungs- und Dokumentationszentrums für Kriegsverbrecherprozesse an der Philipps-Universität Marburg.
[36] https://www.ipg-journal.de/interviews/artikel/man-muss-es-voelkermord-nennen-8447/
[37] https://www.juedische-allgemeine.de/politik/die-genozid-luege/
[38] https://news.rub.de/wissenschaft/2024-07-04-interview-der-begriff-voelkermord-ist-fuer-juristen-zur-last-geworden
[39] Professor für Holocaust Studies and Jewish Studies an der Touro University Berlin.
[40] Prof. Dr. Sabine Swoboda, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafprozessrecht und Internationales Strafrecht an der Ruhr-Universität Bochum
[41] https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal/doku-rueckkehr-nach-israel-100.html
[42] https://qantara.de/artikel/interview-mit-irena-steinfeld-erstmals-%C3%A4gypter-als-gerechter-unter-den-v%C3%B6lkern und https://qantara.de/artikel/muslime-retten-juden-im-zweiten-weltkrieg-es-gibt-sie-die-orientalischen-schindlers
[43] https://www.bpb.de/shop/zeitschriften/apuz/israel-2023/520482/75-jahre-nach-der-nakba/
[44] https://www.bpb.de/themen/antisemitismus/dossier-antisemitismus/321671/flucht-und-vertreibung-von-juden-aus-den-arabischen-laendern/
[46] https://deutsche-islam-konferenz.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Studien/uem-abschlussbericht.pdf?__blob=publicationFile&v=11
© Bildnachweis: KI-generiertes Bild mit Midjourney