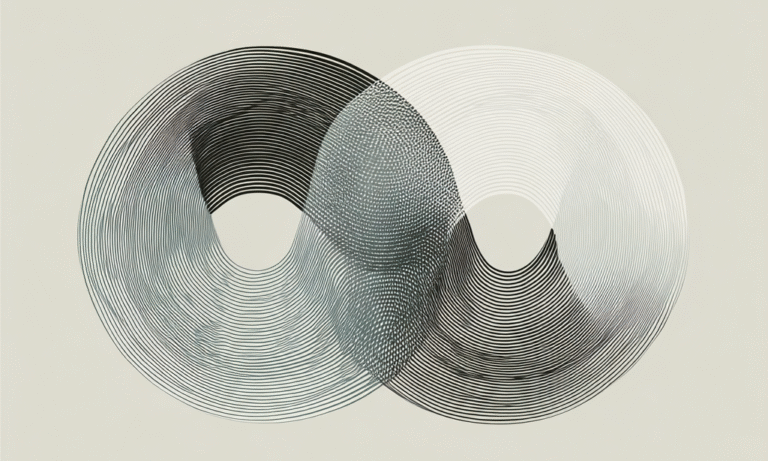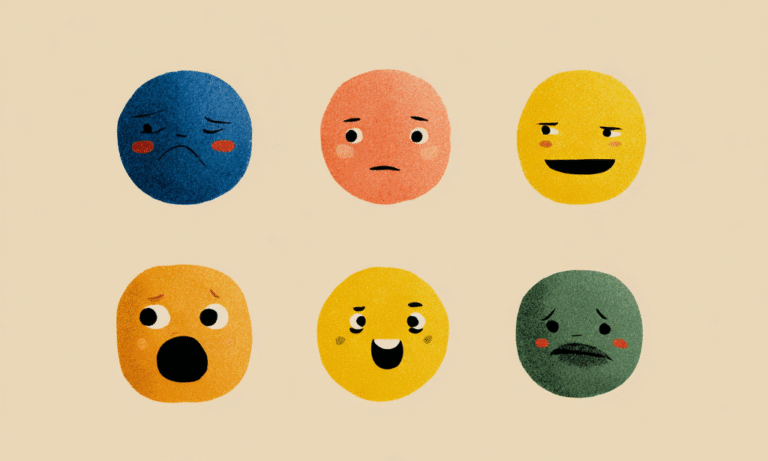Mit dem Comicprojekt „Wie geht es dir? Zeichnerinnen gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus“ haben Künstler*innen Anfang 2024 eine Initiative gestartet, die nach dem 7. Oktober Raum für Mitgefühl und Dialog schaffen will. In Gesprächen mit 60 Menschen, die von Antisemitismus und Rassismus betroffen sind oder sich mit menschenfeindlichen Ideologien befassen, entstanden gezeichnete Porträts – alle beginnend mit der Frage: „Wie geht es dir?“. Im Interview mit ufuq.de berichten die Projektteilnehmenden Amal und Benji – sie mit palästinensischer, er mit jüdischer Familiengeschichte – von ihren Erfahrungen und Gefühlen nach dem 7. Oktober, Mitinitiatorin Nathalie Frank schildert den Entstehungsprozess des Projekts.
Judith De Santis (ufuq.de):
Liebe Nathalie, du hast gemeinsam mit anderen Zeichner*innen das Projekt „Wie geht es dir? Zeichner*innen gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus“ ins Leben gerufen – daraus ist ein Comicband entstanden. Was wolltet ihr mit der Initiative bewirken und wie sind die Comics konzipiert?
Nathalie Frank:
Das Projekt entstand im Herbst 2023, in einer Zeit großer Erschütterung. Wir, eine Gruppe von Comic-Künstler*innen aus Deutschland, waren tief betroffen von den Ereignissen rund um den 7. Oktober und dem darauffolgenden Krieg in Gaza. Doch auch in Deutschland waren die Auswirkungen spürbar: Gesellschaftliche Spannungen und Polarisierungen nahmen rasch zu. Diese Entwicklungen haben uns erschüttert, verunsichert und bewegt – und den Wunsch geweckt, darauf künstlerisch zu reagieren. Schnell war klar: Wir wollten Geschichten erzählen. Von Menschen, die direkt oder indirekt vom Nahostkonflikt betroffen sind. Von Leben, die sich auch hier, in Deutschland, seit dem 7. Oktober spürbar verändert haben. Wir wollten sichtbar machen, wie stark und unterschiedlich dieser Konflikt in das Leben Einzelner eingreift – und auch für ein empathisches Zuhören plädieren. Deshalb beginnt jeder Comic mit der schlichten, aber kraftvollen Frage: Wie geht es dir?
Judith De Santis:
Die Form des Comics ist besonders, dazu kommen wir gleich noch. Zuerst wollen wir auf die Antworten zu der Frage Wie geht es dir? schauen.
Liebe Amal, lieber Benji, diese Frage wirkt zunächst einfach, doch das ist sie vermutlich nicht. Wie war es für euch, in der Zeit nach dem 7. Oktober darauf zu antworten? Und was kann eine solche Frage eurer Meinung nach gesellschaftlich bewirken oder sichtbar machen?
Amal:
Die Frage zu beantworten war alles andere als einfach. Meine Gefühle waren sehr gemischt, nicht eine Emotion davon positiv. Auch heute noch ist die Frage für mich nicht leicht zu beantworten. Wenn ich gefragt werde, wie es mir geht, sage ich immer: „Den Umständen entsprechend.“ Ich lebe hier in Sicherheit und muss meinem Alltag wie gewohnt nachgehen – während meine Familie leidet. Alles scheint irrelevant.
Ich denke, dass die Frage nicht so klein ist, wie sie scheint. Würde man sie anderen Menschen stellen, würden die meisten sagen: „Ich habe Angst, ich mache mir Sorgen, die Zukunft scheint unsicher.“ Den Menschen fehlt der Raum, um ihre Emotionen zu fühlen. Dabei kann die Auswirkung auf die Gesellschaft nur positiv sein. Zu merken, dass man die gleichen Emotionen teilt, ist sehr wichtig. Uns Menschen vereint viel mehr, als uns spaltet. Das wurde auch meiner lieben Freundin und Schwester Rahel und mir bei unserem gemeinsamen Kaffee bewusst. Wir beide leiden. Das Narrativ, es gäbe zwei Seiten, die gegeneinander arbeiten und nicht koexistieren können, ist grundsätzlich falsch. Um zu diesem Schluss zu kommen, reicht auch die „ganz simple“ Frage Wie geht es dir?
Benji:
Für mich war es damals schon schwer, auf die Frage zu antworten, weil sie mir kaum bis gar nicht gestellt wurde. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass die Gesellschaft auch nur im Ansatz daran interessiert war, mir und anderen betroffenen Menschen den Raum zu geben, zu trauern und zu reflektieren. Vielmehr fühlte ich mich wie eine Projektionsfläche, die man für sich vereinnahmen darf. Die Frage, wo ich stehe, was meine Position ist, was ich denn vom Leid der jeweils „anderen Seite“ halte, dominierte in meinem Leben mehr als die Frage, wie es mir geht. Ich hätte nie gedacht, dass aus einer so einfachen Frage wie Wie geht es dir? ein zweistündiges Gespräch entstehen würde – vielleicht, weil sie mich ins Hier und Jetzt geholt hat. Weil sich jemand wirklich dafür interessiert hat, was in mir persönlich vorgeht.
Gerade deshalb halte ich so eine Frage auch gesamtgesellschaftlich für so wichtig: Weil sich Menschen dadurch auch als Menschen wahrgenommen fühlen. Sie vermittelt, dass ihre Gefühle einen Platz in dieser Welt haben dürfen. Das gilt besonders für diesen Konflikt, wo meiner Meinung nach Menschen, die rein gar nichts mit dem Konflikt zu tun haben, sich mehr damit beschäftigen, eine Position beziehen zu müssen und dabei selektiven Humanismus betreiben, als auf die Gefühlswelt von allen Betroffenen einzugehen.
Judith De Santis:
Inwiefern hat sich euer Alltag in Deutschland nach dem 7. Oktober verändert?
Amal:
Ich fühle mich immer noch wie gelähmt. Seit nun schon eineinhalb Jahren sehe ich jeden Tag die grauenvollen Bilder aus Gaza. Während der Schock des 7. Oktobers und des darauffolgenden Krieges für den Großteil der Gemeinschaft hier bereits verarbeitet ist, erlebe ich ihn jeden Tag aufs Neue. Es wird nicht leichter. Ich gehe so gut es geht meinem Alltag, der Arbeit, dem Sport nach, gehe mit Freunden aus. Doch immer wieder schießen mir die Bilder der Verletzten und Toten in Gaza in den Kopf. Dinge, die mir wichtig erschienen, sind es nicht mehr. Der Alltag fühlt sich unglaublich absurd und auch einsam an. Während sich für andere die Welt einfach weiterdreht, steht meine Welt seit 1,5 Jahren still.
Benji:
Für mich hat sich das Leben danach echt verändert. Mein Sicherheitsgefühl, das schon mein ganzes Leben eher brüchig war hinsichtlich meiner jüdischen Identität, war noch nie so gering wie in dieser Zeit des grassierenden Antisemitismus. Ich bin viel vorsichtiger geworden im Alltag. Ich fühlte mich schon eine Zeit lang ausgeliefert und hatte eher das Gefühl, meinen Platz in der Welt verteidigen zu müssen. Dieses „Ja, aber …“ war wirklich unerträglich, als müsste das Leid meiner Gemeinschaft dauernd relativiert werden. Wie auch im Comic dargestellt, hat sich auch mein Verhältnis zur Mehrheitsgesellschaft nachhaltig verändert – nach wie vor fühle ich mich mehr als „Jude in Deutschland“. Ich brauchte eine Weile, um zu realisieren, dass ich das allein nicht schaffe. Mir hat es geholfen, meine jüdischen Spaces aufzusuchen, wo ich mich am meisten geborgen fühle, was mir sehr viel Kraft geschenkt hat. Gleichzeitig bin ich selbstbewusster geworden und habe meine nicht-jüdischen Freund*innen von mir konfrontiert und gefragt, warum sie sich nicht bei mir gemeldet haben, und ich stehe für meine Gefühle mehr ein.
Judith De Santis:
Der Nahostkonflikt ist ein historisch und politisch vielschichtiges Thema. Für viele ist es schwer zugänglich. Der Krieg hat zudem zu einer starken Lagerbildung geführt, die offene Gespräche zusätzlich erschwert. Was ist euch persönlich wichtig, wenn ihr über den Nahostkonflikt sprecht?
Amal:
Die Vielschichtigkeit des Nahostkonflikts darf kein Grund sein, das Gespräch darüber zu scheuen. Im Gegenteil: Gerade deshalb ist es wichtig, unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen. Gleichzeitig darf sie nicht als Vorwand dienen, um die Menschenrechtsverletzungen, die seit 77 Jahren begangen werden, nicht klar zu benennen. Aktuell werden die Menschen in Gaza und der West Bank kollektiv bestraft, wobei nicht zur Debatte stehen darf, ob Palästinenser*innen ein Recht haben, in Würde und Sicherheit zu leben. Es sind in erster Linie unschuldige Zivilist*innen, die leiden. Es existieren klare Resolutionen, die bis heute nicht eingehalten werden, wodurch die Koexistenz der beiden Staaten aktiv verhindert wird. Ohne die Anerkennung, dass auch Palästina ein Existenzrecht hat, fehlt jeder Debatte eine nachhaltige Grundlage.
Die starke Lagerbildung, zu meinen, man müsse sich für eine Seite entscheiden, ist völlig absurd. Wir können und müssen koexistieren, damit langfristig für alle Betroffenen ein Leben in Sicherheit gewährleistet werden kann. Solange das Leid und das Existenzrecht aller Betroffenen nicht anerkannt wird, verliert jede Diskussion ihren Sinn und Zweck.
Die Menschen in den Debatten werden dadurch viel zu schnell vergessen. Während viel über „Wer hat angefangen“ und „Wer hat recht“ diskutiert wird, vergisst man schnell, dass es Menschen gibt, die aktiv betroffen sind und deren Leben von Entscheidungen abhängt, auf die sie selbst keinen Einfluss haben. Es werden Leben gegeneinander aufgewogen und internationale Rechte nicht anerkannt, dadurch fehlt in Gesprächen eine gemeinsame Basis. Leider wird dadurch auch schmerzhaft klar, dass man in Deutschland aus der Vergangenheit nichts gelernt hat.
Benji:
Ich habe mal einen Sticker gesehen, auf dem stand: „It’s not a soccer match.“ Das bringt es auf den Punkt! Mich regt es sehr auf, wenn Menschen, die nichts mit dem Konflikt oder der Region zu tun haben, so tun, als ob gerade der FC Barcelona gegen Real Madrid spielt und man einfach auswählen kann, welche Seite man unterstützt. Sorry, das ist selektiver Humanismus wie aus dem Lehrbuch.
Mir ist in erster Linie wichtig darauf hinzuweisen, dass dieser Konflikt Menschenleben auf beiden Seiten fordert. Viele Menschen, sowohl in der Region als auch in der Diaspora, sind emotional mit diesem Konflikt verbunden. Gerade dieser Umstand sollte Außenstehende doch verleiten, allen Betroffenen des Konfliktes den Raum zu geben, ihre Ängste und Sorgen zu teilen, statt die Menschen zu vereinnahmen. Für das Leben in unserer Gesellschaft ist mir auch wichtig, dass jede*r von uns sich die Frage stellen sollte, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben und möchte das auch nicht hinnehmen, dass auf Demonstrationen „Tod den Juden!“ gerufen wird.
Ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo das Leid der jüdischen, israelischen und palästinensischen Gemeinschaft sichtbar ist. Und in der besonders junge Menschen, die über Social Media oft ungefiltert mit traumatisierenden Inhalten konfrontiert werden, auch emotional aufgefangen werden.
Judith De Santis:
Vielen Dank, Amal und Benji, für eure Offenheit.
Nathalie, im Vorwort des Comicbands schreibt ihr als Herausgeber*innen: „Gerade die Zeichnung und der Comic können unserer Erfahrung nach individuelle Geschichten erzählen, aufklären und Nähe schaffen, ohne Menschen und ihre persönlichen Schicksale dabei auszustellen.“ Kannst du das näher erläutern?
Nathalie Frank:
Die Form des Comics erzeugt eine interessante Spannung zwischen Nähe und Distanz. Nähe, weil das Zeichnen einer Person eine sehr persönliche, langsame und manuelle Geste ist, die einen Eindruck von Intimität vermittelt. Distanz, weil die gezeichnete Person gewissermaßen zu einer Comicfigur wird: So wird sie, selbst wenn sie realistisch gezeichnet ist, abstrakter als wenn man ein Foto oder einen Film von ihr zeigen würde. Gerade dadurch wird die tatsächliche Intimität der porträtierten Person gewahrt. Und paradoxerweise schafft diese Distanz wieder Nähe: Denn mit einer Comicfigur kann man sich, so finde ich, oft leichter identifizieren als mit einer realen Person auf einem Foto, die eindeutig nicht ich bin.
Judith De Santis:
Ich vermute, dass es nicht immer leicht war, Menschen zu finden, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind und sich nach dem 7. Oktober öffentlich äußern wollten – gerade angesichts der gesellschaftlichen Polarisierung im Zusammenhang mit dem Israel-Palästina-Krieg und dem Erstarken rechter Politik in Deutschland. Wie habt ihr eure Dialogpartner*innen gefunden und wie wurde eure Projektidee aufgenommen?
Nathalie Frank:
Die Suche nach Gesprächspartner*innen verlief ganz organisch. Zunächst fragten wir im eigenen Umfeld – bei Freund*innen und Bekannten – und wandten uns dann gezielt an Personen, die sich beispielsweise in Kunsträumen oder in den Medien äußern und deren Stimme wir als wichtig und interessant empfanden. Deshalb vereint das Projekt sowohl bekannte Persönlichkeiten als auch Menschen, die es manchmal vorzogen, anonym zu bleiben, wie meine beiden Gesprächspartner*innen Amal und Benji. Anonymität lässt sich im Comic sehr leicht umsetzen, und wir haben diese Möglichkeit allen angeboten, die dies wünschten.
Von Beginn an wollten wir mit diesem Projekt vor allem unseren Dialogpartner*innen eine Stimme geben und ihre Perspektive sichtbar machen. Deshalb arbeiteten Künstler*innen und Dialogpartner*innen eng zusammen: Nach dem Interview begleiteten die Dialogpartner*innen die Entstehung des Comics und schlugen Änderungen am Storyboard und später am Comic vor. Veröffentlicht wurde nur mit ihrer Zustimmung – uns war wichtig, dass sie sich gut repräsentiert fühlen.
Alle Beteiligten arbeiteten ehrenamtlich, getragen vom gemeinsamen Anliegen, mit diesen Geschichten einen Beitrag gegen Polarisierung und für mehr Empathie zu leisten. Insgesamt wurde das Projekt sowohl von den Dialogpartner*innen als auch von der Leserschaft sehr positiv aufgenommen: Oft hörten wir, dass ihnen die nebeneinanderstehenden Comics eine andere Perspektive auf diesen Konflikt eröffneten – auf eine andere Realität, der sie bisher weniger Beachtung geschenkt hatten.
Judith De Santis:
Gerade in Zeiten multipler Konflikte und Krisen ist es uns bei ufuq.de ein Anliegen, Räume für Emotionen, Kontroversen, Perspektivenvielfalt und offenen Dialog zu bewahren. Euer Comicband leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Habt ihr Pläne, das Projekt in irgendeiner (künstlerischen) Form fortzusetzen?
Nathalie Frank:
Uns ist bewusst, dass wir die Serie Wie geht es dir? noch lange hätten fortsetzen können – und dass wir sie beendet haben, obwohl der Krieg weiter andauert und sich die Lage dramatisch zuspitzt. Das Projekt erforderte viel Koordinations- und redaktionelle Arbeit sowie wöchentliche Treffen. Wir haben wie gesagt alle ehrenamtlich gearbeitet. Nach fast einem Jahr und der Veröffentlichung von 60 Comics auf unserer Website und auf Instagram, die jetzt in Buchform erschienen sind, haben wir beschlossen, die Serie einzustellen. Eine Fortsetzung der künstlerischen Arbeit ist derzeit nicht geplant.
Jetzt widmen wir uns den öffentlichen und pädagogischen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Projekt: Eine Ausstellung der Comics tourt durch ganz Deutschland, die wir mit Lesungen und Workshops begleiten. Zudem entstehen Unterrichtsmaterialien für Lehrkräfte und Multiplikator*innen.
Das Projekt ist sehr lebendig und gibt Anlass zu vielen Diskussionen und Begegnungen – was auch unser Wunsch war und worüber wir uns sehr freuen.
© Bildnachweis: Ausschnitte aus den Comics mit Amal und Benji, gezeichnet von Nathalie Frank, aus dem Comicband „Wie geht es dir? – Sechzig gezeichnete Gespräche nach dem 7. Oktober 2023“.

„Wie geht es dir?“ Ein Comicprojekt nach dem 7. Oktober
„Wie geht es dir? Zeichner*innen gegen Antisemitismus, Hass und Rassismus“ ist ein Projekt, das im Januar 2024 von einer Gruppe von Comic-Künstler*innen ins Leben gerufen wurde – darunter Nathalie Frank, Hannah Brinkmann, Michael Jordan, Moritz Stetter, Birgit Weyhe und Barbara Yelin, begleitet von Dr. Véronique Sina (Goethe-Universität Frankfurt) und dem Team des Internationalen Comic-Salons Erlangen, später ergänzt mit Julia Kleinbeck.
Im Zentrum stehen Gespräche mit Menschen nach dem 7. Oktober 2023, die von Antisemitismus, Hass und Rassismus betroffen sind oder sich mit menschenfeindlichen Ideologien auseinandersetzen. Ziel des Projekts ist es, Perspektiven von Betroffenen sichtbar zu machen und einen empathischen Raum für Dialog, Zuhören und das Aushalten verschiedener Positionen zu eröffnen.
Aus dem Projekt ist der Comicband „Wie geht es dir? – Sechzig gezeichnete Gespräche nach dem 7. Oktober 2023“ entstanden. Alle Beiträge sind online zugänglich unter: wiegehtesdir-comics.de

Unterrichtsvorschläge zum Comicprojekt
Das Bildungsprogramm des New Israel Fund Deutschland e.V. hat gemeinsam mit den Initiator*innen des Comicprojekts „Wie geht es dir?“ pädagogische Materialien entwickelt. Ziel ist es, Lehrkräfte bei der sensiblen Behandlung von Antisemitismus, Rassismus und Vielfalt in der Bildungsarbeit zu unterstützen. Entstanden sind zwei Unterrichtsvorschläge, die sich mit dem Umgang mit Emotionen sowie mit Emotionen und Biografien beschäftigen.
Die Materialien sind online zugänglich unter: https://www.nif-deutschland.de/wp-content/uploads/2025/06/Unterrichtsvorschlage-_-Wie-geht-es-Dir.pdf